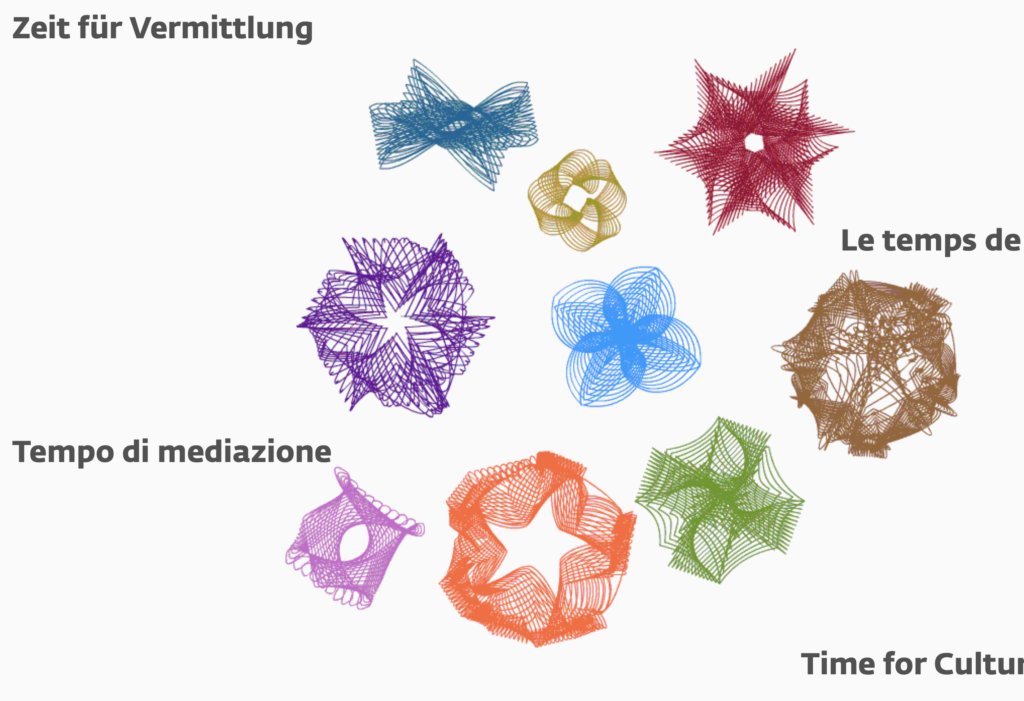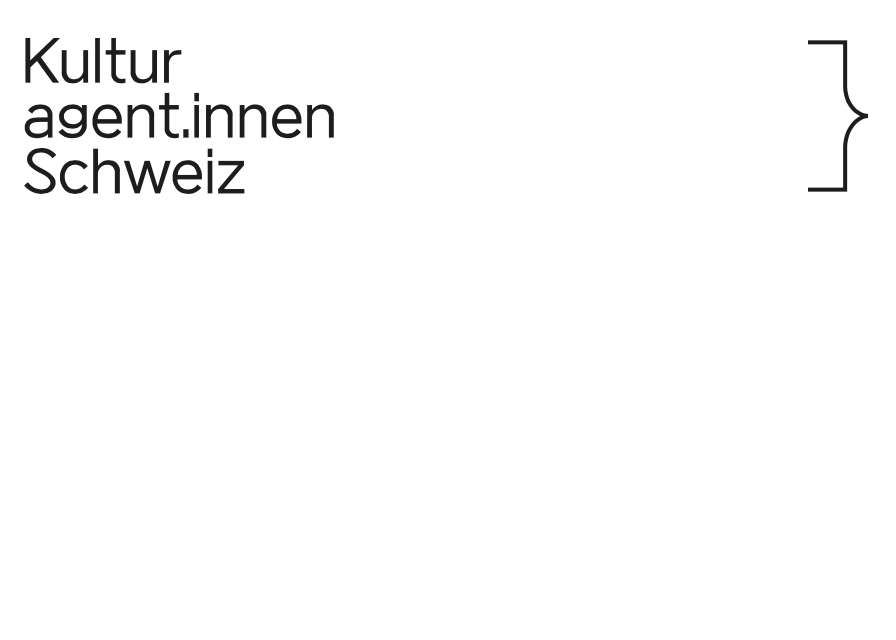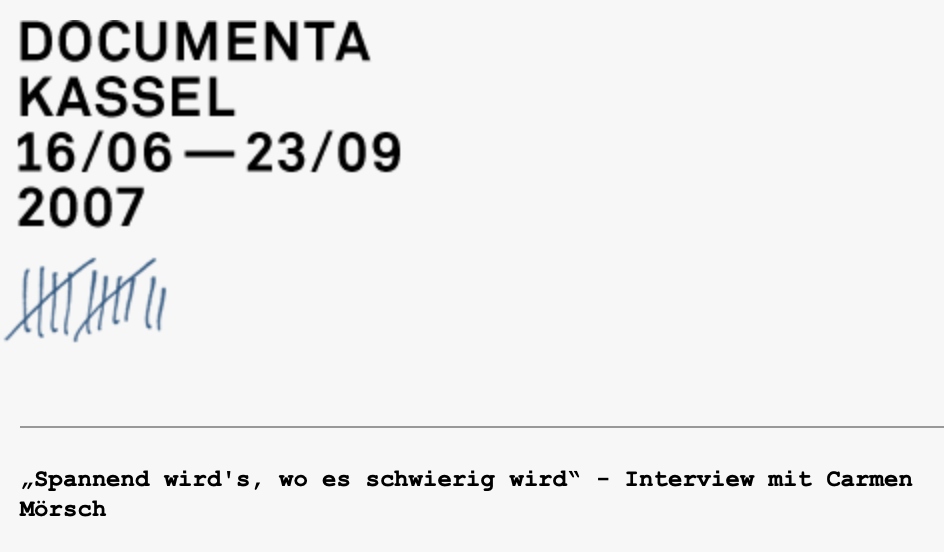Zeitgenössisch vermitteln
Über Kunst informieren, über Kunst in einen Austausch treten, auf Kunst reagieren – das alles kann Vermittlung in einer Ausstellung oder im Museum generell. Und noch viel mehr. In unserer Einführung (1/4) haben wir bereits kurz erklärt, warum wir uns in diesem Beitrag mit kultureller Bildung beschäftigen und was wir unter zeitgenössischer Kulturvermittlung verstehen. Es geht um die Schlüsselbegriffe progressiv, inklusiv und demokratisch. Wie sich Vermittlung äußert, das hat sich in den letzten Jahren ständig erweitert. Die klassische Führung ist längst nicht mehr das einzige Tool, um tiefer in ein Kunstwerk oder Themen einer Ausstellung abzutauchen. Im Selbsttest haben wir Formate ausprobiert, die neue Zugänge suchen. Natürlich kamen wir dabei – Corona sei Dank – an der digitalen Kunstvermittlung nicht vorbei.
.
Bevor wir in das Thema der Kunst- und Kulturvermittlung abtauchen, lassen wir zuerst die Expertin sprechen. Martina Oberprantacher war nicht nur am Institute for Art Education in Zürich tätig, sondern bis 2020 auch Leitung der Vermittlungsabteilung im Lenbachhaus in München. Mit dem Jahr 2020 ist die Südtirolerin nach Meran gewechselt, wo sie jetzt das Ausstellungshaus Kunstmeranoarte leitet. Sie kennt nicht nur Trends in der musealen (und außermusealen) Vermittlung, sondern weiß vor allem um die Komplexität des Themas, an dem sie wissenschaftlich intensiv geforscht hat. Erkenntnisse, die sie in ihrer Arbeit u.a. in München in die Praxis umgesetzt hat. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Mit Martina haben wir also vor allem über allgemeine Fragestellungen gesprochen, über Zugänglichkeit ebenso wie über die Problematik mit dem Begriff „Zielgruppe“. Für Martina ist ganz klar: Gute Vermittlung ist kontextbezogen. Und Museen im deutschsprachigen Raum haben in puncto Vermittlung noch einiges aufzuholen. Das habe auch die aktuelle Pandemie gezeigt.
Weitere spannende Ansätze gibt es, wenn ihr weiterscrollt. Hopp! Hopp!

Bild: Andreas Marini
Martina Oberprantacher
Martina Oberprantacher (*1979) ist Kunstvermittlerin und Museumsleiterin in Meran. Sie studierte Kunstgeschichte im Hauptfach und Philosophie, Kulturwissenschaften, Ur-und Frühgeschichte sowie Romanistik im Fächerbündel an der Universität Innsbruck sowie an der Freien Universität zu Berlin. Sie arbeitete u.a. für die Manifesta 7 in Südtirol/Trentino und später als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Art Education der ZHdK in Zürich. Von 2013 bis 2020 war sie die Leiterin der Bildung und Vermittlung an der Städtischen Galerie am Lenbachhaus und Kunstbau München, 2020 wechselte sie als Direktorin ins Kunstmeranoarte nach Meran. 2021 wird das 25-jährige Jubiläum des Hauses gefeiert.
EINS ZU EINS*
* Martina Oberprantacher fordert: Das Verhältnis von fix angestellten Vermittler*innen und Kurator*innen an einer Kunstinstitution sollte
1 zu 1 sein.
Martina Oberprantacher: Dank der Pandemie blieben zuletzt ja vor allem der digitale Raum, aber nicht nur. Beim Thema der Formate möchte ich auch darauf hinweisen, dass man genau unterscheiden sollte: Was ist public program oder Rahmenprogramm und was ist Vermittlung? In der Vermittlung realisiert man ja hauptsächlich Programme, in denen die Frage nach Beteiligung im Mittelpunkt steht; sprich Lernformen, die durch Beteiligung möglich werden. Das können klassische Formate sein, wie Führungen. Es gibt jeweils Schnittstellen zum Rahmenprogramm, zum Beispiel in Form von Vorträgen etc. Gerade im Bereich Vermittlung, wenn ich an Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen denke, finde ich das Format Workshop sehr spannend, ebenso Kollaborationen, Kooperationen mit Schulen. Konkret interessiert mich gerade, wie verändert sich Lernen durch kollektive Zusammenarbeit, durch Beteiligung. Und mich interessiert ebenso der Aspekt, welche Rolle Ästhetik in diesem Zusammenhang spielt. Also auch wie Inhalt und Form zusammenfinden, auch bezogen auf die Wahl von Methoden. Ich finde auch die Frage spannend, ob es die Möglichkeit gibt, eine Art Formel zu entwickeln. Kann man eine Art grobes Gerüst entwickeln, das im Rahmen eines Schulprogramms funktionieren könnte? Also ein Gerüst, in dem Inhalt oder Materialien von den Beteiligten selbst ausgesucht werden können; die methodische Arbeit wird hingegen vorgegeben.
Für wen wird Vermittlung gemacht? Gibt es bei jedem Programm eine bestimmte Zielgruppe?
Was ist für dich gute Vermittlung?
Oberprantacher: Grundsätzlich finde ich viele Formate spannend, es geht darum, dass sie kontextbezogen sein müssen. Die zentrale Frage ist, für welchen Kontext entwickle ich welches Format? Entscheidungsprozesse müssen jeweils hinterfragt werden: Wo, wie, wann werden Entscheidungen getroffen und für wen? Warum dieser Inhalt und nicht ein anderer, warum diese Form und nicht eine andere? Gute Vermittlung beginnt bei der Vorbereitung, mit der Haltung, dem Verständnis. Dabei gibt es oft Projekte, die unterschiedliche Formate in einem vereinen, Formen fließen auch ineinander über. Neben der Frage, wie entwickelt wird, geht es bei guter Vermittlung auch darum, mit wem und für wen Formate entwickelt werden. Was ich auf jeden Fall auch unter guter Vermittlung verstehe, ist keine Reduktion der Komplexität. Das wird der Vermittlung ja oft vorgeworfen, dass sie banal wird, wenn man alle möglichen Personengruppen ins Museum holen möchte. Allein dieser Vorwurf ist schon absolut politisch inkorrekt, das zeigt nur, dass der Vorwurf von Personen kommt, die ihren eigenen Hintergrund selbst nie hinterfragen.
rOberprantacher: Ja, genau. Der Anspruch ist immer der gleiche, vom Niveau her gesehen. Die Komplexität muss beibehalten werden, die Zugänge müssen geschaffen und ständig überdacht werden. Die Künstlerin und Kunstvermittlerin Carmen Mörsch hat dazu einmal gesagt: „Die Vermittlung muss mindestens genauso komplex sein, wie die Kunst, die sie vermittelt.“ Die Frage ist nun eben, wie man sich die Komplexität erarbeitet. Vermittlung ist wie das Kuratieren einer Disziplin, die sich viel mit Theorie und Inhalt beschäftigt, obwohl es ein praxisbezogenes Arbeiten ist.
Oberprantacher: Das ist eine gute Entwicklung. Weil es nicht nur Personen, Insider gibt, die mit dem Inhalt und der Sprache gut vertraut sind. Das ist auch nicht nur eine Frage von Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen, ich kenne genug Menschen, die studiert haben, mit diesem speziellen Kunstjargon oder einem politischen Jargon aber nicht vertraut sind. Wenn ich stets nur hochkomplexe Texte an die Wand knalle, also Texte, die von einem Sprachniveau C1 oder C2 ausgehen, signalisiere ich dem*der Besucher*in, der*die nicht auf diesem Sprachniveau kommuniziert, ja auch, dass sie nicht genug wissen, um diesen Text zu verstehen. Ich frage mich, ob ein Museum für zeitgenössische Kunst, ein solches Sprachniveau voraussetzen muss oder ob es nicht auch möglich wäre, Inhalte zu vermitteln, die nicht primär über Sprache funktionieren und trotzdem das Wissen fordern und Interesse wecken. Gerade bei der Erstellung von Saaltexten habe ich gelernt, dass es vorteilhaft sein kann, den Text auch mal einem Nicht-Insider vorzulegen. Die Expertise darf in der Vermittlung nicht nur bei einem selbst und der eigenen Institution verortet werden. Da gilt es Autorität abzugeben. Und somit auch eine geteilte, kollektive Autor*innenschaft anzupeilen.
Du bist als Leiterin der Vermittlung im Münchner Lenbachhaus in die Direktion des Kunstmeran gewechselt. Wenn du uns nochmal von deiner Münchner Zeit erzählen könntest: Wie war die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in Lenbachhaus? Wie wurde gearbeitet?
Oberprantacher: In München war ich für viele Jahre die einzig feste Vermittlerin am Haus. Das war in der Vorbereitung für Ausstellungen für mich nicht nur einfach, weil meine ersten Ansprechpartner*innen stets die hausinternen Kurator*innen waren, nicht andere Vermittler*innen. Bei Projekten unabhängig von den Ausstellungen arbeitete ich hingegen intensiv mit dem Team der freien Vermittler*innen zusammen. Das ist auch mein Anraten: Vermittlungsprogramm muss auch unabhängig des Ausstellungsprogramm gedacht werden, es ist wichtig, nicht nur ausstellungsspezifisches Programm zu konzipieren. Der Fokus kann dann auf unterschiedlichen Kernthemen liegen. Man sollte versuchen, die Essenz des Programms zu extrahieren: Welche Aussagen gibt es? Was ist das Spannende an der künstlerischen Praxis? Wie war der Umgang mit dem künstlerischen Material? Wie werden Themen erarbeitet? Das Problematischste an der Vermittlung ist, wenn künstlerisches Arbeiten imitiert wird. Da kann man eigentlich nur scheitern. Es geht auch beim Vermitteln darum, eine eigene Sprache zu entwickeln. In München gab es ein Bewusstsein über die verschiedenen Problematiken. Am Lenbachhaus hat man besonders in den letzten Jahren etwa vermehrt auf Texte in einfacher Sprache gesetzt. Erstellt wurden sie von Expert*innen, die sich mit dieser Perspektive schon länger beschäftigen, was ich als eine gute Entwicklung wahrgenommen habe.
“Man merkt, der Bedarf ist da: Kinder wollen kreativ sein.”
– Doris Oberholzer
“Das Problematischste an der Vermittlung ist, wenn künstlerisches Arbeiten imitiert wird. Da kann man eigentlich nur scheitern. Es geht auch beim Vermitteln darum, eine eigene Sprache zu entwickeln.”
– Martina Oberprantacher
Ein Ansatz, den du auch nach Meran mitgebracht hast?
Welche Projekte haben bisher am besten funktioniert? Gibt es ein Projekt, das dir im Kopf geblieben ist?
Oberprantacher: Die besten Projekte waren immer jene, die man gern konzipiert hat, bei denen aber auch gleich klar war, dass es eine enorme Lust gibt, sie umzusetzen. Ein Projekt am Lenbachhaus ist mir besonders im Kopf geblieben: Ein Filmprojekt, eine Hommage an den Filmemacher Friedrich Wilhelm Murnau. Kunstvermittler*innen haben gemeinsam mit Student*innen der Filmhochschule das Projekt konzipiert und umgesetzt. Das Ziel war es, einen Vampirfilm für Erwachsene zu drehen, der in unterschiedlichen Arbeitsgruppen gemeinsam erarbeitet wurde. Das Interessante daran war natürlich, einmal die Möglichkeit zu haben, einen Film zu machen. Ich persönlich habe sehr viel gelernt. Mir sind auch unsere Langzeitprojekte in Erinnerung geblieben, etwa die Figurentheater-Werkstatt für Kinder und Jugendliche im Lenbachhaus, die es bis heute gibt. Entwickelt wurde das Konzept von den beiden Künstler*innen Mirja Reuter und Florian Gass, die viel Erfahrung mit Figurentheater, Malerei und Video haben, ebenso wie mit dem Umfang eines solchen Projekts; die Aufführungen wurden schließlich in einem großen Zelt und mit viel technischem Equipment gezeigt. Die Schüler*innen haben selbst Geschichten entwickelt, nachdem wir ihnen einige Werke aus dem Museum präsentiert und mit ihnen darüber gesprochen haben. In der Gruppe wurde entweder ein Figurentheater oder eine Performance zu einem Werk gemeinsam entwickelt. Alle Geschichten des Figurentheaters waren allerdings absolut frei inszeniert, basierten auch nicht auf historischem Hintergrund der Werke oder Ähnlichem. Es ging wirklich um die Geschichte. Bei den angesprochenen Performances hingegen lag der Fokus auf der Recherche im Archiv, im Zentrum stand hier die Frage nach Provenienz, also wie ein bestimmtes Werk überhaupt ins Lenbachhaus gekommen war. Ich bekam durch dieses Projekt erstmals einen Einblick, wie Kinder das Museum und seine Werke wahrnehmen. Und was man nicht vergessen darf: Der Lerneffekt ist dann, wenn Kinder selbst entscheiden, selbst Regie führen, besonders hoch. Das Projekt war auch darauf ausgelegt, jeder Moment war eine Entscheidung.
Gut vermittelt ist also, wenn das Publikum aktiviert wird, selbst einen Beitrag zu leisten?
Oberprantacher: Absolut! Das ist absolut notwendig. Es sollte meiner Meinung nach nicht nur aktiviert, sondern auch ermächtigt werden, Entscheidungen zu fällen. Das muss man natürlich auch lernen. Es braucht dazu das richtige Setting, Vertrauen in der Gruppe, ein angenehmes Ambiente. In der Vermittlung gibt es auf alle Fälle kein Schema A, nach dem jedes Projekt konzipiert werden kann.
Kann man in der Vermittlung bestimmte Trends ausmachen?
Oberprantacher: Es gibt viele Vermittler*innen, die sehr gut arbeiten – auch außerhalb von Museen. Beispiele von guter Vermittlung kommen ganz klar auch aus der freien Kinder- und Jugendarbeit. In der Vermittlung ist es übrigens kein Fauxpas, wenn man Projekte für sich adaptiert.
Gibt es für dich eine Institution, die du als Vorbild nennen kannst?
Oberprantacher: Ich finde die Manifesta als Institution macht sehr gute Arbeit. Die Ausgangssituation ist ja nicht einfach, weil man sich bei jeder Ausgabe in einem neuen Kontext zurechtfinden muss. Zumindest von außen nehme ich wahr, dass etliche Kooperationen eingegangen werden und umtriebig gearbeitet wird. Im Auge behalten sollte man das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, spannend ebenso die Arbeit von lab.Bode im Bodemuseum oder dem K20 in Düsseldorf. Auch die Kunsthalle Wien ist für seine gute Vermittlung bekannt, hier wurde etwa der Aspekt der Dramaturgie eingeführt, wodurch das Kuratorische mit dem Vermittlerischen noch enger verbunden wird. Natürlich sollte man auch die vielen kleinen Projekte nicht übersehen, die NGBK in Berlin, die jährlich ein Kunstvermittlungsstipendium vergibt. Die Kunstcoop war ja dort tätig, die erste Genossenschaft, die Vermittlungsarbeit an der NGBK eingeführt hat und den außermusealen Vermittlungsaspekt thematisiert hat. Ich nehme gerade bei solchen Initiativen viel Flexibilität wahr, anders als bei Museen, die oftmals Gefahr laufen, ein bestimmtes Repertoire ständig zu wiederholen. Denn es ist wichtig, ständig neu zu überlegen, was gibt es abseits von Führungen oder Workshops noch für Möglichkeiten? Kleine Institutionen schaffen es besser, aus diesem Regelwerk auszubrechen. Für alles Digitale hingegen gilt es den US-amerikanischen und angelsächsischen Bereich im Auge zu behalten, der hier absolute Vorreiter ist.
Wird man in Zukunft mehr Budget in Vermittlung stecken?
Oberprantacher: Das wird wohl leider ein Lippenbekenntnis bleiben. In Museen spielt Vermittlungsarbeit in Bezug auf Personen, die dort im Vermittlungsbereich arbeiten, eine marginale Rolle. Kulturstiftungen haben hier viel ermöglicht, in Zukunft liegt die Verantwortung aber auch in den Kommunen, langfristig Personen bzw. Stellen einzurichten und den Vermittlungsbereich damit besser auszustatten. Das Verhältnis zwischen Vermittler*innen und Kurator*innen am Haus müsste meiner Meinung nach mindestens 1:1 sein. Natürlich hinkt der Vergleich mit Rieseninstitutionen wie der Tate, dort gibt es zum Beispiel allein in der Vermittlung sieben oder acht Fachbereiche. Hier spricht man außerdem ganz klar von Kurator*innen von Vermittlung. Die Perspektive ist eine ganz andere.
Was bleibt von der Digitalisierungszwang der Coronazeit?
Oberprantacher: Ich glaube, Corona hat die Digitalisierung erst ins Bewusstsein gerückt. Es gibt Institutionen, die schon länger mit digitaler Kunstvermittlung gearbeitet haben. Andere haben es verabsäumt und bekommen, genauso wie Schulen, jetzt die Rechnung präsentiert. Das Digitale ist weder gut noch schlecht, es ist einfach präsent und wir werden uns weiterhin damit beschäftigen. Ich persönlich schätze ja auch das analoge Arbeiten und freue mich darauf, sobald es wieder möglich sein wird. Deshalb weiß ich dennoch um die Wichtigkeit des Digitalen, auch weil sich Vieles absolut bewährt hat. Nehmen wir Veranstaltungen, die einfacher durchführbar werden, weil man etwa von zuhause aus teilnehmen kann. Und das international! Für mich bleibt die Frage, was für eine ästhetische Erfahrung bleibt? Fix ist: In Bezug auf ästhetische und soziale Fragen reicht das Digitale dem Analogen bisher noch nicht das Wasser. Da geht noch was!
Martina
Oberprantacher
liest aktuell:
„Das Medium ist die Massage von Marshall McLuhan“, das zurecht als Kultbuch bezeichnet wird.
hört aktuell:
Viel Radio, weil man da der Welt – hier wie andernorts – ein wenig näher rückt.
schaut aktuell:
Wie andere Kunstvereine durch ein spannendes Programm den Moment des Stillstands überbrücken.
empfiehlt:
Der Digitalisierung nicht nur etwas Pragmatisches, sondern vielleicht auch etwas Unerwartetes abzugewinnen?!
Die Manifesta - The Nomadic European Biennial ist, wie der Name schon verrät, die europäische Biennale für zeitgenössische Kunst, deren Ausstellungsorte alle zwei Jahre wechseln. Die erste Manifesta fand 1996 in Rotterdam statt. Anlässlich ihrer 13. Ausgabe wechselte die Manifesta 2020 nach Marseille. 2022 gastiert die Manifesta 14 in Prishtina.
SONOGRAPHIE MARSEILLAISE – Euphonia
Künstler, Wissenschaftler und Einheimische enthüllten im Rahmen der Manifesta 13 die Geschichte der Stadt in einer Konstellation von Klängen und Kradiokreationen.
Quelle: klick
Das lab.Bode ist eine Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen. In drei Vermittlungsräumen im Berliner Bodemuseum wird die Vermittlungsarbeit sichtbar, in Berlin arbeitet die Initiative eng mit neun Partnerschulen zusammen. Bundesweit können sich Museen bei lab.Bode bewerben, die Vermittlungsarbeit in ihrer Institution einen höheren Stellenwert einräumen möchten. 23 wissenschaftliche Volontär*innen arbeiten an den jeweiligen Museen und begleiten Projekte im Bode-Museum. Durch das Programm wird die Ausbildung der Vermittler*innen professionalisiert. Lab.Bode lädt außerdem im Rahmen von Vorträgen und Workshops zum Austausch über aktuelle Ansätze, Theorien und Perspektiven der Vermittlungsarbeit.
> lab.Bode